Im September 2023 hat die Bundesregierung die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen veröffentlicht. Diese markiert ein drastisches Umdenken hinsichtlich der Perspektive, die Deutschland auf Fortschritt, Innovation und gesellschaftliche Teilhabe einnimmt.
In elf Handlungsfeldern möchte sie die Veränderungskraft Sozialer Innovationen fördern. Es geht ihr dabei unter anderem um die Stärkung der sozialinnovativen Gründungskultur, um die Ausgestaltung von Förderinstrumenten für Sozialinnovator:innen und eine verstärkte Forschung rund um Soziale Innovationen. Wie kam es dazu und was bezweckt die Bundesregierung damit?
Der Glaube an Fortschritt durch Technik
Deutschland war schon immer ein wichtiger Ort für Soziale Innovationen: Kranken- und Rentenkassen, Genossenschaften und die Wohlfahrtpflege sind alles Sozial Innovationen “Made in Germany“. Trotz der großen Veränderungen, die diese Art von Innovationen mit sich brachten, war es allerdings der Glaube an Fortschritt durch Technik, der zu einer der wichtigsten Triebkräfte des letzten Jahrhunderts wurde.
Und das aus gutem Grund: Technische Innovationen brachten der Gesellschaft größeren Wohlstand und den Menschen eine höhere Lebenserwartung. Impfungen, motorisierte Fortbewegung, künstliche Düngemittel, Pestizide und viele weitere Errungenschaften ermöglichten einen bis dato nicht gekannten Lebensstandard.
Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Denn dieselben technischen Erfindungen, die so viel Positives bewirkt haben, unterminieren gleichzeitig die Grundlage, auf dem dieser Wohlstand aufgebaut ist. In unserem im August im oekom-Verlag erschienenen Buch „Soziale Innovationen – Lösungen, wie wir sie wirklich brauchen“ beleuchten wir einige dieser zwiespältigen Entwicklungen genauer.

Menschengemachte Herausforderungen
Landwirtschaftliche ausgelaugte Böden gefährden die Sicherstellung ausreichender Ernährung; Wohlstandsungleichheit bringt die Gesellschaft in Schieflage; die Klimakrise zeigt konkret ihre bedrohlichen Folgen; immer knapper werdende Ressourcen gefährden den technischen Fortschritt und das Bildungssystem bereitet die jüngere Generation nicht ausreichend auf die vor ihr liegenden Krisen und Konflikte vor.
Diese Herausforderungen sind größtenteils menschengemacht. Viele stehen in direktem Zusammenhang mit der Technik, die wir tagtäglich nutzen. Doch entscheidend für die Auswirkungen ist das menschliche Handeln: Erst unser aller Verhalten entscheidet über die Auswirkungen von Technik und den tatsächlichen Einfluss gesellschaftlicher Institutionen.
Um Lösungen für Probleme wie oben genannte zu finden, muss das Verhalten von Menschen in den Blick genommen werden, von Individuen wie von Gruppen. Es gilt, sich anzuschauen, wie Verhaltensänderungen zustande kommen und wie die Nutzung von Technik bzw. die Verbreitung von Technik beeinflusst werden kann.
Um das Ganze konkreter darzustellen, tauchen wir in ein ebenso naheliegendes wie überraschendes Beispiel ein: Spültoiletten.
Ein Beispiel
Kaum jemand macht sich bei seinen täglichen Gängen zum stillen Örtchen Gedanken darüber, welch hohe soziale wie ökologische Kosten dieses in sich trägt. Denn was mit dem Spülwasser weggeschwemmt wird, enthält viele wertvolle Ressourcen; u.a. auch Stickstoff und Phosphat, zwei der drei wichtigsten Grundstoffe für Düngemittel.
„Menschliche Fäkalien enthalten Nährstoffe, die – korrekt aufbereitet und qualitätsgesichert – als Recyclingdünger das Pflanzenwachstum fördern und in Deutschland bis zu 25 % der konventionellen synthetisch-mineralischen Dünger ersetzen können.“, schreibt das Netzwerk für nachhaltige Sanitärsysteme e.V., ein Verein, der sich für die Sanitär- und Nährstoffwende einsetzt. Bisher ist Deutschland in Bezug auf Phosphor noch stark abhängig von Exportländern – eine Abhängigkeit, die im Ernstfall unsere Ernährungssicherheit bedroht.
Nicht zu schweigen von den schieren Unmengen an Wasser, die die Toilette bei jedem Spülgang herunterfließen. „Mit dem Gang zur Toilette verbraucht ganz Deutschland somit jedes Jahr insgesamt über 1 Milliarde Kubikmeter Frischwasser. Das ist mehr als das Volumen der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands“, klärt das Netzwerk weiter auf. Auf dem Bertelsmann Blog transforming economies schreiben die Initiator:innen des Netzwerks, dass in Deutschland „täglich etwa ein Drittel unseres kostbaren Trinkwasserbedarfs für die Toilettenspülung“ verschwendet wird.
Dabei bleibt es jedoch nicht. Denn obwohl Toilettenabwässer heute schon aufwendig gereinigt werden, finden sich weiterhin Rückstände von Krankheitserregern, Arzneimitteln und Hormonen in ihnen. Befinden sich noch organische Stoffe im geklärten Abwasser, können diese zudem in Oberflächengewässern zur übermäßigen Nährstoffanreicherung beitragen und die Ökosysteme gefährden.

Lösung des Problems: Die Technik ist vorhanden
Das „Müssen müssen“ können wir nicht abstellen. Dennoch ist die Lösung für die fehl- oder nicht genutzten Abwässer zumindest von technischer Seite her vergleichsweise simpel: die Trockentoilette. In ihr werden die festen und flüssigen Bestandteile menschlicher Ausscheidungen voneinander getrennt. Das macht die sachgemäße, schadlose und sichere Weiterverarbeitung von menschlichen Exkrementen zu wertvollem Humusdünger möglich.
Und das Beste: Seit einigen Jahren arbeiten in Deutschland bereits einige Startups an funktionierenden technischen Innovationen rund um das Thema Sanitärwende. Die Technik ist bereits da. Doch ihre breite Implementierung scheitert noch an den Rahmenbedingungen.
Denn bei einer so tiefgreifenden Veränderung wie der Sanitärwende spielt der infrastrukturelle Aspekt eine wichtige Rolle. Neben dem Einbau von Trockentoiletten in der Breite gehört zu jeder Trockentoilette ein regionales System von Transport und Wiederaufbereitung, was derzeit noch nicht existiert. Auch aus gesetzlicher Sicht ist es noch nicht so einfach, diese innovativen Systeme einzuführen – denn Dünger aus menschlichen Ausscheidungen sind bisher noch nicht zugelassen.
Aber vor allem braucht das neue System die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die eigenen Routinen und Gewohnheiten zu ändern kostet Mühe, Kraft und Nerven – egal, ob man öfter Sport machen, mehr Lesen oder weniger Fastfood zu sich zu nehmen will. Bei einem geradezu intimen Vorgang wie der Toilettenhygiene ist das nicht anders. Die Kosten für den Umbau, hygienische Aspekte und die etwas vom herkömmlichen Prozedere abweichende Anwendung dürften gewisse Hürden für die Akzeptanz der Toiletten darstellen. Doch nur wenn genug Menschen bereit sind, Trockentoiletten zu nutzen, kann auch die lokale Infrastruktur um sie herum aufgebaut werden.
Eine soziale Innovation ist für die Wende nötig
Hier kommen Soziale Innovationen ins Spiel. Soziale Innovationen definieren wir als eine Veränderung des Verhaltens einer großen Anzahl an Menschen, sodass die Systeme, in denen sie leben, sich zukunftsfähiger und nachhaltiger ausrichten. Während es sich also bei der Trockentoilette um eine an sich technische Innovation handelt, ist der Prozess der Einführung eine soziale.
Die ersten Tests neuer Sanitärsysteme – und wie diese für die Nutzer:innen auf akzeptable Weise angeboten und verbreitet werden – gibt es bereits. Einige Beispiele werden auf der Webseite der Sanitärwende-Bewegung genauer beschreiben. Mit dem Projekt „zirkulierbar“ haben wir in Deutschland auch ein großangelegtes Forschungsprojekt. In Eberswalde, gleich vor den Toren von Berlin, wird neben der technischen Umsetzbarkeit auch die soziale Akzeptanz geprüft.
Das Beispiel zeigt: Ja, wir brauchen technische Innovationen. Aber vor allem brauchen wir Neuerungen im Handeln der Menschen. Welche Sanitäranlagen wir einbauen, wie wir unser Geschäft verrichten und wie Politiker:innen die Gesellschaft auf den Wandel vorbereiten, entscheidet über den Erfolg der Sanitärwende.
Der kleine Ausflug in die Welt des stillen Örtchens ist nur ein kleines Beispiel für die notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft. Wie Menschen konsumieren, arbeiten, wählen, sich engagieren, Lehre gestalten, ihre Freizeit gestalten, … alle sozialen Praktiken haben eine Auswirkung auf Umfeld und Umwelt. Es ist diese Akkumulation an Handlungen, die unsere Gesellschaft tagtäglich von neuem entstehen lässt.
Soziale Innovationen ermöglichen zukunftsfähige Gesellschaften
Mit Sozialen Innovationen haben wir nun eine Möglichkeit, diesen Aspekt genauer betrachten zu können. Sie fokussieren sich auf Neuerungen in den sozialen Praktiken von vielen Menschen, um nachhaltigere und zukunftsfähigere Gesellschaften zu ermöglichen. Technik und technische Innovationen nehmen durch die Perspektive der Sozialen Innovationen ein geringeres Gewicht ein. Denn erst unser Umgang mit Technik – dass wir sie in unser Handeln einbeziehen – entfaltet ihre Wirkung. Ansonsten bestünde sie nur aus Gadgets, die in der Ecke rumliegen. Technik wird hier nur zu einem Mittel zum Zweck.
Stattdessen geraten diejenigen Akteure in den Vordergrund, die Soziale Innovationen entwickeln. Das sind Vereine wie das Netzwerk für nachhaltige Sanitärsysteme e.V. von oben, Verbände, Sozialunternehmen oder auch „nur“ Privatpersonen oder lose Netzwerke.
Nach einem langen Hiatus, in dem nur technische Innovationen im Mittelpunkt der Fortschrittsanstrengungen Deutschlands lagen, kommen Soziale Innovationen nun wieder auf das Tableau.
Die nationale Strategie: mutiger Vorstoß mit blinden Flecken
Die nationale Strategie ist ein mutiger Vorstoß. Insbesondere im Hinblick darauf, dass er von allen Ministerien mitgetragen wird. Die Bundesregierung markiert ihren bis dato blinden Fleck, aufgrund dessen sie Soziale Innovationen mehr als stiefmütterlich behandelt hat. Die Strategie ist insofern ein Startschuss für ein sozialinnovatives Deutschland.
Beim Lesen der nationalen Strategie fällt jedoch auf, dass die Bundesregierung die Tragweite Sozialer Innovationen noch nicht vollständig erfasst hat. Zu oft verfällt sie in das eingefahrene Denken, bei dem Startups und Vermarktbarkeit die wichtigsten Gestaltungsfaktoren zu sein scheinen.
Doch erfolgreiche Soziale Innovationen sind meist mehr und größer als ein singuläres Gründungsunternehmen. Sie entstehen in der Forschung, in der Zivilgesellschaft, in der Verwaltung und vor allem: Im Austausch loser Netzwerke und in den Köpfen individueller Sozialinnovator:innen. Nur mit dieser gemeinsamen Schlagkraft können komplexe Vorhaben wie die Sanitärwende erfolgreich umgesetzt werden.
Die Strategie nennt im Titel als erstes „Soziale Innovationen“, doch dafür schwingt das Thema Unternehmertum noch zu stark mit. Zu den ersten Maßnahmen im Dokument werden Finanzmärkte und KMU-Förderprogramme genannt. Doch nicht alle Soziale Innovationen sind Unternehmen – im alten Sinne des Wortes.
Hier haben wir uns mehr erhofft: Dass Soziale Innovationen als das gesehen werden, was sie sind. Vielfältig, komplex, emergent, nicht notwendigerweise profitorientiert.
Trotz aller Kritik an der Strategie freuen wir uns auf die nächsten Jahre, in denen Sozialen Innovationen ein größeres und das ihnen gebührende Gewicht zukommt. Wir sind sicher, dass wir in der kommenden Zeit einen wahren Boom an sozialinnovativen Initiativen, Projekten und ja, auch gemeinwohlorientierten Unternehmen sehen werden. Auch die Arbeit der Forschung durch Erarbeitung von Wissen und Methodik wird zu einer erfolgreichen Etablierung von Sozialen Innovationen beitragen. Es bleibt spannend in Deutschland!
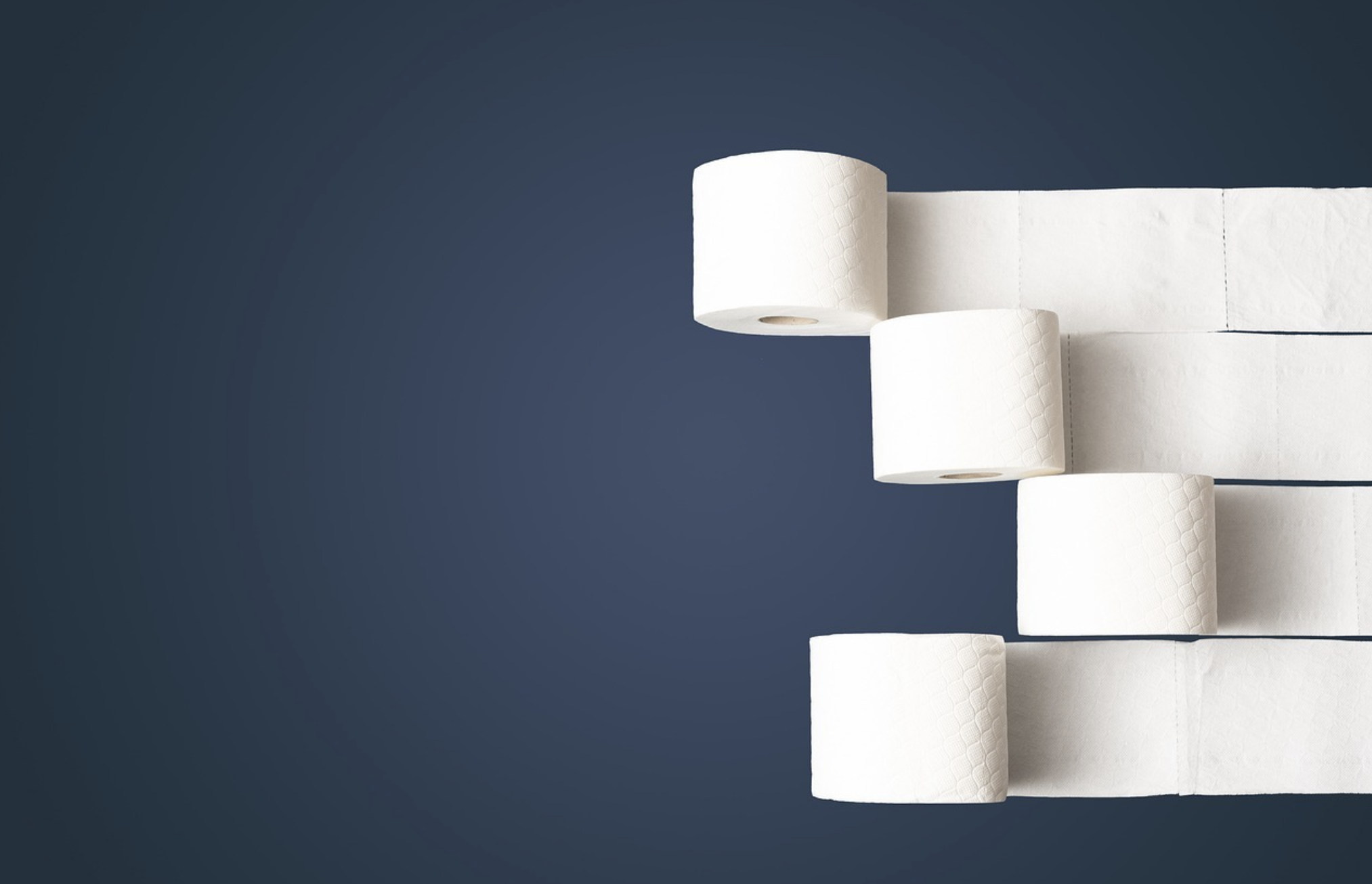
Im September 2023 hat die Bundesregierung die Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen veröffentlicht. Diese markiert ein drastisches Umdenken hinsichtlich der Perspektive, die Deutschland auf Fortschritt, Innovation und gesellschaftliche Teilhabe einnimmt.
In elf Handlungsfeldern möchte sie die Veränderungskraft Sozialer Innovationen fördern. Es geht ihr dabei unter anderem um die Stärkung der sozialinnovativen Gründungskultur, um die Ausgestaltung von Förderinstrumenten für Sozialinnovator:innen und eine verstärkte Forschung rund um Soziale Innovationen. Wie kam es dazu und was bezweckt die Bundesregierung damit?
Der Glaube an Fortschritt durch Technik
Deutschland war schon immer ein wichtiger Ort für Soziale Innovationen: Kranken- und Rentenkassen, Genossenschaften und die Wohlfahrtpflege sind alles Sozial Innovationen “Made in Germany“. Trotz der großen Veränderungen, die diese Art von Innovationen mit sich brachten, war es allerdings der Glaube an Fortschritt durch Technik, der zu einer der wichtigsten Triebkräfte des letzten Jahrhunderts wurde.
Und das aus gutem Grund: Technische Innovationen brachten der Gesellschaft größeren Wohlstand und den Menschen eine höhere Lebenserwartung. Impfungen, motorisierte Fortbewegung, künstliche Düngemittel, Pestizide und viele weitere Errungenschaften ermöglichten einen bis dato nicht gekannten Lebensstandard.
Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Denn dieselben technischen Erfindungen, die so viel Positives bewirkt haben, unterminieren gleichzeitig die Grundlage, auf dem dieser Wohlstand aufgebaut ist. In unserem im August im oekom-Verlag erschienenen Buch „Soziale Innovationen – Lösungen, wie wir sie wirklich brauchen“ beleuchten wir einige dieser zwiespältigen Entwicklungen genauer.